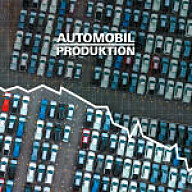Steht Großbritanniens Autoindustrie vor dem Aus?
Die Zukunftsprognosen für die britische Automobilindustrie sind nicht gut. Lediglich die Luxusmarken sorgen für Lichtblicke.
(Bild: Adobe Stock: elenvd, janaluchenko / Nissan)
Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Sechs Jahre nach dem Brexit-Referendum liegt die britische Automobilindustrie am Boden – und die Prognosen für den englischen Patienten geben kaum Anlass zum Optimismus.
Es war so etwas wie Hilferuf von der Intensivstation: Fast bettelnd hat die britische Automobilindustrie Ende Juli bei der EU um einen Aufschub der Brexit-Zölle auf E-Autos gebeten, die ab 2024 gelten sollen. Aus gutem Grund: Weil die steigenden Anforderungen an den lokalen Anteil der Wertschöpfung innerhalb Großbritanniens oder der EU kaum zu erfüllen sein werden, könnten diese Schranken vor dem wichtigsten Exportmarkt für die wenigen verbliebenen Werke auf der Insel dem englischen Patienten gar den Todesstoß versetzen, fürchten Experten. Nicht umsonst warnt der ehemalige Nissan- und Aston-Martin-Boss Andy Palmer bereits vor dem Verlust von 800.000 Arbeitsplätzen.
Warum steckt die britische Autowirtschaft in der Krise?
„Was für ein Abstieg“, staunt Arthur Kipferler vom Strategieberater Berylls: „Früher war England so etwas wie der japanische Flugzeugträger vor Europas Küste und für die Autohersteller auf dem Kontinent eine echte Bedrohung“, sagt der Experte mit Verweis auf die Werke etwa von Honda in Swindon oder Nissan in Sunderland. „Doch mit dem Brexit hat ein Niedergang begonnen, der kaum mehr aufzuhalten ist“, fasst er die Stimmung zusammen. Und die Zahlen geben ihm Recht: Haben die Briten 2016 im Jahr des Referendums noch 1,7 Millionen Autos gebaut, waren es 2022 nur noch 775.000 und damit schon wieder zehn Prozent weniger als im Jahr davor.
Den Grund dafür sieht er nicht allein in der erschwerten Logistik mit längeren Laufzeiten und höheren Kosten, in endlos viel Bürokratie und neuen Hürden in einem früher grenzenlosen Handel. Sondern Schuld daran sei vor allem die sich ständig selbst verstärkende Abwärtsspirale: „In diesem problematischen Umfeld tun sich die Hersteller mit Produktionsentscheidungen und den dafür notwendigen langfristigen Investitionen sehr schwer“, sagt er. Und jede Entscheidung für ein Werk in einem anderen Land, ja schon jeder öffentlich geäußerte Zweifel wie zuletzt der von Stellantis-Chef Carlos Tavares wiederum erschüttere das Zutrauen der Zulieferer, die es im Umfeld der Werke für eine stabile Automobilindustrie brauche. „Denn mit den wenigen verbleibenden Fabriken im Land und der schrumpfenden Produktion fällt es schwer, die Lieferanten zu ernähren oder sie zu Investitionen in neue Anlagen und Standorte zu bewegen.“
Aber das alles bedrohende Risiko ist die Rules of Origin-Klausel im Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, urteilt Philip Dunne, Partner bei Roland Berger in London. Sie besagt, dass ab Januar 2024 mindestens 45 Prozent der Teile eines in Großbritannien montierten Elektrofahrzeugs auch von dort stammen müssen, andernfalls wird beim Export in die EU ein Zoll von zehn Prozent fällig. Das könnte teuer werden. Denn aktuell gehen 80 Prozent der britischen Produktion in den Export – und mehr als die Hälfte davon in die EU. „Ein Zoll von zehn Prozent würde die Montage in Großbritannien unrentabel machen“, sagt Dunne und glaubt, dass dann viele internationale Hersteller abwandern oder gar nicht erst nach England kommen würden.
Das Problem dabei sind die Batterien, die 40 bis 60 Prozent des Fahrzeugwerts ausmachen. Und für die gäbe es im Vereinigten Königreich aktuell weder Produktionsanlagen oder gar Gigafactories noch einen realistischen Plan zu deren Errichtung. Zwar versuchten einige Hersteller das jetzt im Alleingang, meldet Dunne. „Aber keines dieser Vorhaben schafft vor 2024 eine industrialisierte Lieferquelle für Batterien.“ Allerdings sei auch die EU mit ihren Plänen im Rückstand, sodass die Neuverhandlung des aktuellen Abkommens im Interesse aller Parteien sei, verbreitet er Optimismus.
Hat Großbritanniens Autoindustrie eine Chance?
Nicht zuletzt deshalb gibt Dunne den englischen Patienten nicht verloren und zitiert hoffnungsvoll aktuelle Statistiken: „Bei den Nutzfahrzeugen ist die Produktion auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren.“ Und auch die Pkw-Fertigung nehme wieder zu, obwohl sie immer noch weit unter dem Niveau vor der Pandemie liege. „Insgesamt sind die Aussichten für die meisten Marken gut. Die FTSE-100-Zulieferer sind ebenfalls in einer starken Position, ebenso wie die großen Händlergruppen.“
Auch Berylls-Experte Kipferler sieht noch ein paar Standort-Vorteile: Die Sprache und das Rechtssystem zum Beispiel seien den Amerikanern in England sehr viel näher als in Kontinentaleuropa. „Und natürlich geht ein Expat lieber nach London als nach Ljubljana.“
Ob Stellantis seine Drohung wahrmacht und die Opel-Produktion aus England abzieht, wie sich der elektrische Mini aus China auf das Werk in Oxford auswirkt, wie lange Ford den Briten noch die Treue hält und wie es mit Nissan in Sunderland weitergeht – da wagt zwar keiner der Experten eine Prognose. Doch zumindest um zwei Nischen muss man sich wohl nicht sorgen. Marken wie Rolls-Royce, Bentley oder Aston Martin seien für ihn ohne das Label Made in England schwer vorstellbar, sagt Autoexperte Stefan Bratzel von der Hochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und gibt dem britischen Oberhaus damit Bestandsschutz, genau wie ein paar Edel-Zulieferern für Leder oder Luxus-Accessoires. Aber mit zusammen nicht einmal 50.000 Einheiten pro Jahr sei eben keine Industrie zu ernähren. Fürs Prestige mag das wichtig sein, für die Gesamtproduktion aber sind diese Marken eher nebensächlich.
Noch kleiner aber möglicherweise sogar wertvoller ist die Formel1-Industrie, die sich fast ausschließlich auf Großbritannien konzentriert. „Denn da wird jede Menge Knowhow generiert, von dem auch die Hersteller diesseits des Kanals profitieren, auch wenn nur wenige Entwicklungen aus der Formel 1 die Serienfahrzeuge befruchten“, sagt Berylls-Mann Kipferler: „Dumm nur, dass selbst zehn F1 Teams nur etwa 10.000 Mitarbeiter beschäftigen – was kein echter Ausgleich für stillgelegte Großserienwerke ist.“