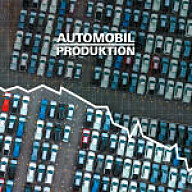Welche Konsequenzen hat VWs Gewinneinbruch auf die Werke?
Wird Volkswagen künftig noch mehr Produktionskapazitäten ins Ausland verlagern?
(Bild: Volkswagen AG)
Der VW-Konzern kämpft mit sinkendem Gewinn und steigenden Kosten. Was das für die Zukunft der Produktionswerke bedeutet, welche Regionen profitieren könnten und wie sich die Neuausrichtung auf Elektromobilität auswirkt, lesen Sie hier.
Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr wegen des harten Wettbewerbs in China und wegen hoher Umbaukosten deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich verdiente VW mit 12,4 Milliarden Euro fast 31 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Aus dem einstigen Gewinnbringer China kam deutlich weniger Ergebnis. Zudem wurden hohe Kosten unter anderem für das Aus des Audi-Werks in Brüssel fällig.
Ob es alternative Möglichkeiten zur Kostensenkung gibt, ohne die Produktion direkt einzuschränken, hängt davon ab, ob 2025 ein Jahr der Erholung für VW wird, betont Pedro Pacheco vom Beratungsunternehmen Gartner. „Unausgelastete Produktionskapazitäten sind immer eine große finanzielle Belastung. Eine Werksschließung bedeutet jedoch oft eine Reduzierung des gesamten Produktionsvolumens – und das ist für einen OEM wie VW, der erneut die weltweite Nummer eins werden will, keine attraktive Option“, so der Experte. VW habe nach wie vor Spielraum, die Produktion von Fahrzeugen derselben Plattform auf eine minimale Anzahl von Werken zu konzentrieren, was erhebliche Kostensenkungen ermöglichen könnte.
Im Tagesgeschäft fiel das operative Ergebnis um gut 15 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Das entsprach einer Marge von 5,9 Prozent nach 7,0 Prozent im Vorjahr. VW hielt sich damit besser als zuletzt selbst avisiert. Der Umsatz legte hingegen um knapp ein Prozent auf 324,7 Milliarden Euro zu.
Könnte Volkswagen einzelne Marken verkaufen?
Branchenkenner Pacheco betont: „Die größte Kostenersparnis für VW wäre eine echte Transformation hin zu einem technologieorientierten Unternehmen. Dies würde es dem Konzern ermöglichen, im Bereich Software und Elektrifizierung deutlich schneller voranzukommen – und das bei erheblich geringeren Kosten." Zudem gebe es wahrscheinlich auch Potenzial, operative Doppelstrukturen zwischen den verschiedenen Marken zu reduzieren oder eine intensivere Technologie-, Spezifikations- und Teile-Nutzung über die Marken hinweg einzuführen. Schließlich, so Pacheco, könnte auch der Verkauf einzelner Marken eine Option sein.
Sind eigene Batteriezellwerke noch der richtige Weg für VW?
Volkswagen kündigte ebenfalls an, den Hochlauf der Batteriezellfertigung an die Marktbedingungen anzupassen. Damit steht der Konzern nicht allein da. Für Pacheco ist der Grund klar. „Mehrere etablierte Automobilhersteller haben ihre Investitionen in batterieelektrische Fahrzeuge aufgrund der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit ihrer BEV-Modelle reduziert." Diese Investitionskürzungen erschwerten es jedoch zusätzlich, entscheidende Meilensteine in der BEV-Entwicklung zu erreichen – insbesondere in der Eigenproduktion von Batteriezellen. Diese sei besonders kostenintensiv, wenn man über erstklassige Technologie verfüge. „Daher stellt sich die Frage, ob es angesichts der Wettbewerbsherausforderungen sinnvoll ist, die Zellproduktion beizubehalten, wenn nicht gleichzeitig weitere Investitionen in diesem Bereich erfolgen."
Deutschland verliert an Stellenwert
Der Anteil der Autos, die 2024 in Deutschland gebaut wurden, ging erneut auf 18,8 (20,6) Prozent zurück. Klar ist: Der geplante Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland deutet auf eine strategische Neuausrichtung hin. Das sieht auch Pedro Pacheco so: „Es gibt seit mehreren Jahren einen klaren Trend zur Verlagerung von Produktionskapazitäten aus kostenintensiven westeuropäischen Ländern nach Osteuropa, in die Türkei, nach Marokko und teilweise auch nach Südeuropa. Daher würde es mich nicht überraschen, wenn der Rückgang der Produktionskapazität in Deutschland durch andere Faktoren in den genannten Regionen kompensiert würde."
Sind Volkswagens E-Autos wettbewerbsfähig?
Volkswagen reduziert schrittweise die Investitionen in Verbrennungsmotoren, setzt aber weiterhin auf Flexibilität, um auf Marktnachfragen zu reagieren. Dadurch entstehen neue Herausforderungen für die Produktionswerke, insbesondere in Bezug auf die Skalierung der Elektrofahrzeugproduktion. „Flexibilität zur Erfüllung der Marktnachfrage zu gewährleisten, ist sehr kostspielig. Insgesamt sollte sich VW darauf konzentrieren, wettbewerbsfähigere Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, da dies kurzfristig das Absatzvolumen und die Rentabilität verbessern würde", sagt Pedro Pacheco.
Zum Vergleich: BYD, dessen Produktionsvolumen größtenteils aus Elektrofahrzeugen besteht, verzeichnete im vergangenen Jahr einen globalen Verkaufsanstieg von über 40 Prozent, „und seine Elektrofahrzeugmodelle führen die weltweiten Verkaufszahlen an. Insgesamt sind die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 deutlich gestiegen", so der Experte. Dies zeige, dass der Markt Elektrofahrzeuge durchaus nachfrage – jedoch nur, wenn sie wettbewerbsfähig seien.
VW-Mitarbeiter erhalten 4.800 Euro Bonus - Kürzung ab 2026
Trotz des Sparkurses zahlt VW seinen Mitarbeiter eine höhere Prämie. Die Tarifbeschäftigten bekommen für das vergangene Jahr fast 4.800 Euro Bonuszahlung. In Summe betrage die Prämie 4.799,50 Euro, hieß es. Belegschaftsmitglieder im VW-Haustarif sollen nach den bereits überwiesenen 1.879,50 Euro mit dem Mai-Gehalt weitere 2.920 Euro erhalten. Damit liegt die Gewinnbeteiligung sogar etwas höher als im vergangenen Jahr, als VW 4.735 Euro an jeden Mitarbeiter auszahlte. Von der Zahlung profitieren rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland. Ausschlaggebend für den Bonus sei das Ergebnis der Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge in den beiden zurückliegenden Jahren. Ab dem kommendem Jahr müssen sich die Mitarbeiter dann auf deutlich weniger Geld einstellen.
Mit Material der dpa.